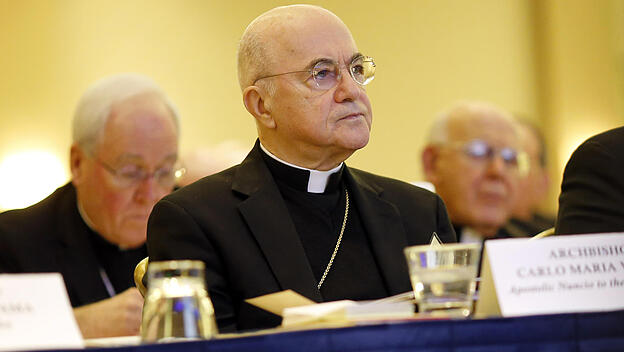Ist es möglich, mit einem verstorbenen Angehörigen zu kommunizieren? Diese Frage stellen sich immer mehr Unternehmen, häufig Start-ups, die versprechen, genau das zu ermöglichen. Sie entwickeln digitale Avatare, die es Verwandten oder Freunden erlauben sollen, mit dem vermeintlichen „Geist“ des Verstorbenen in Kontakt zu treten. Ein solcher Avatar repräsentiert eine Art virtuelles Abbild der Person im digitalen Raum, das mit ihrer Stimme und ihren Erinnerungen ausgestattet wird. Durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz sollen diese Avatare sogar in der Lage sein, entsprechend der Persönlichkeit des Verstorbenen auf neue Situationen zu reagieren und sich weiterzuentwickeln.
Der Dokumentarfilm „Eternal You. Vom Ende der Endlichkeit“ schildert anhand mehrerer Beispiele, wie Menschen mit diesen digitalen Abbildern interagieren: Joshua chattet mit dem digitalen Klon seiner verstorbenen ersten Liebe, Christi möchte wissen, ob es ihrem verstorbenen Freund im Himmel gut geht, Jang Ji-Sung trifft den virtuellen Klon ihrer verstorbenen siebenjährigen Tochter. Die Anbieter erhoffen sich einen lukrativen Markt, denn viele Menschen versuchen, den Tod nicht durch die religiöse Hoffnung auf ein ewiges Leben zu überwinden, sondern durch neue technologische Möglichkeiten. Der Film liefert somit einen bemerkenswerten Beitrag zur Frage, inwieweit KI eingesetzt werden kann und sollte.
Herr Bock, Herr Riesewieck, wie kamen Sie zu diesem eher abseitigen Thema für Ihren neuesten Dokumentarfilm?
Hans Block: Im Jahr 2018 stolperten wir über eine Website, auf der Fragen wie „Wer will unsterblich werden?“ oder „Willst Du für immer leben?“ gestellt wurden. Dahinter verbarg sich ein Fellow am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT), der gerade ein Start-up gegründet hatte. Er wollte die Möglichkeit entwickeln, mithilfe digitaler Daten KI-Avatare zu erschaffen, die nach unserem Tod „weiterleben“ können. Diese Idee faszinierte uns und wir besuchten ihn in Rumänien. Dort erzählte er uns, dass bereits über 30.000 Menschen auf einer Warteliste stünden.
Wenn ein Avatar erstellt wird – entwickelt er sich weiter oder bleibt er gewissermaßen auf dem Stand stehen, den der Verstorbenen bei seinem Ableben hatte?
Moritz Riesewieck: Die Frage hat uns sehr beschäftigt. Denn wenn der Avatar statisch bleibt, kann man eigentlich nicht von einem Weiterleben sprechen. Die neuen Entwicklungen in der Künstlichen Intelligenz (KI) sollen jedoch ermöglichen, dass ein Avatar gemäß der Persönlichkeit des Verstorbenen flexibel auf neue Situationen reagiert und glaubwürdige Antworten darauf generiert, die dem oder der Verstorbenen entsprechen sollen.
Im Gegensatz zu den Versprechungen anderer transhumanistischer Industrien, das Leben zu verlängern, hat der Verstorbene aber herbei ja nicht einmal etwas davon …
Hans Block: Das mag auf den ersten Blick so erscheinen. Doch für viele Menschen ist es tröstlich zu wissen, dass etwas von ihnen bleibt, dass ihre Gedanken und Erinnerungen weiterleben. Der Fokus unseres Films hat sich im Laufe der Recherche von der persönlichen Unsterblichkeit hin zu den Angehörigen verschoben. Die Hinterbliebenen nutzen diesen Service, um noch einmal mit ihren verstorbenen Liebsten zu kommunizieren.
Moritz Riesewieck: Einige Forscherinnen und Forscher glauben, dass es möglich ist, menschliches Bewusstsein künstlich zu erzeugen. Wir zeigen den Forscher Mark Sagar, der mit seiner Firma „Soul Machines“ eine virtuelle Kopie seines eigenen Kindes geschaffen hat. Er argumentiert, dass Bewusstsein nicht zwangsläufig an Materie gebunden sei, sondern eher ein emergentes Phänomen ist, das durchaus auch durch eine Simulation reproduziert werden kann.
Kann eine klare Trennlinie zwischen Forschung und Geschäft gezogen werden?
Hans Block: Das Geschäft mit dem Tod kann besonders perfide sein, wenn es die Trauernden ausnutzt. Viele Entwickler sind zwar fasziniert von ihrer Technologie, verlieren aber oft den moralischen Kompass aus den Augen. Die Kommerzialisierung spielt zweifellos eine große Rolle, da es sich um einen potenziell lukrativen Markt handelt.
Moritz Riesewieck: Der KI-Forscher Carl Öhman sagt als Kommentator in unserem Film, das sei das perfekte Produkt, das sich selbst vermarkte und unverzichtbar mache. Man spielt mit dem moralischen Empfinden der Hinterbliebenen, und nimmt deren Gefühle in Gefangenschaft.
In Ihrem Film sind auch gläubige Menschen zu sehen, die an ein wirkliches Leben nach dem Tod glauben. Konnten Sie einen Unterschied feststellen?
Moritz Riesewieck: Ja, wir haben für unseren Film Christi Angel aus New York getroffen, eine gläubige Christin, die den Service nutzt, um herauszufinden, wie es ihrer ersten Liebe im Jenseits geht. Für sie ist es jedoch ein moralisches Dilemma, da sie glaubt, es sei sündhaft, direkt mit dem Verstorbenen zu kommunizieren. Sie fühlt sich schuldig und handelt deshalb heimlich, ohne es ihrer Mutter zu erzählen. Als sie jedoch eine verstörende Antwort erhält, ist sie erschüttert.
Hans Block: Studien zeigen, dass trotz des Rückgangs traditioneller religiöser Überzeugungen der Wunsch nach Trost und Hoffnung nach dem Tod bestehen bleibt. Die KI wird oft als eine Art moderner Gott angesehen, dessen Entscheidungen für uns unergründlich bleiben.
Wollten Sie mit Ihrem Film dem Zuschauer das Urteil überlassen?
Hans Block: Unser Ziel war es, die Motivationen und Beweggründe der Menschen nachvollziehbar zu machen, die sich mit solchen Technologien beschäftigen. Wir möchten dazu ermutigen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ohne vorschnelle Urteile zu fällen. Gleichzeitig eröffnen wir ethische und moralische Debatten im Zusammenhang mit solchen Technologien.
Es gibt sicher auch einen Unterschied, ob es sich um eine Privat- oder um eine öffentliche Person handelt?
Moritz Riesewieck: Wer sind die Ghostwriter dieses Avatars? In welchem Namen wird eigentlich gesprochen? Technologien, die das menschliche Leben und den Tod betreffen, werfen viele Herausforderungen auf. Es ist wichtig, dass wir diese Fragen nicht nur als individuelle Entscheidungen betrachten, sondern als gesellschaftliche Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.
Hans Block: Es geht auch um den kulturellen und gesellschaftlichen Wandel, der mit der Technologie einhergeht. Es ist wichtig, die Komplexität und die unterschiedlichen Perspektiven dieses Themas zu erkennen. Wir hoffen, dass unser Film dazu beiträgt, diese Diskussionen anzustoßen.
Buchhinweis: Moritz Riesewieck, Hans Block. „Vom Ende der Endlichkeit. Unsterblichkeit im Zeitalter Künstlicher Intelligenz“. Goldmann Verlag, München 2022, ISBN 978-3-442-31662-5, 400 Seiten, EUR 15,–
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.