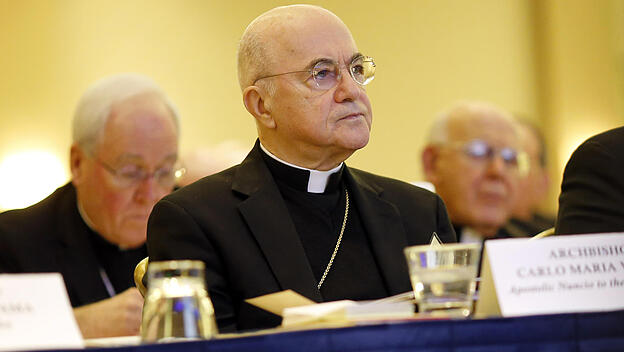Über die Gefahren des „Dark Webs“ ist viel geschrieben worden. In diesem verborgenen Teil des Internets, in dem Anonymität durch ausgeklügelte Techniken gewahrt bleibt und Geldbewegungen ebenfalls anonym verlaufen, tummeln sich Drogen-, Waffen- und Menschenhandel, einschließlich Kinderprostitution.
Im Spielfilm „The Artifice Girl – Sie ist nicht real“ hat ein Programmierer namens Gareth (Autor und Regisseur Franklin Ritch) ein „künstliches Mädchen“ namens Cherry erschaffen, um Pädophile anzulocken. Das Projekt hat die Aufmerksamkeit der Behörden erregt. Special Agent Dena Helms (Sinda Nichols) und ihr Partner Special Agent Amos McCullough (David Girard) wissen, dass Gareth in Bereichen des Internets unterwegs war, in denen er nicht hätte sein sollen. Sie möchten herausfinden, ob er ein selbsternannter „Jäger“ oder eher ein Täter ist. Der zweite Akt spielt 15 Jahre später. In dieser Zeit haben die Behörden mit Cherrys Hilfe hunderte Pädophile verhaftet. Die zugrunde liegende KI hat sich stetig weiterentwickelt. Derzeit wird erwogen, ihre Software in ein kindliches Roboter-Modell zu übertragen, das Cherrys Aussehen nachempfunden ist. Nun stellt sich die Frage, ob bestimmte Entscheidungen, die Cherry betreffen, nicht ihre Einwilligung erfordern.
Ein Avatar namens Cherry
Der letzte Abschnitt des Films ist offensichtlich etliche Jahre später angesiedelt: Gareth (nun von Lance Henriksen dargestellt) ist ein alter Mann im Rollstuhl. Er teilt sich sein Zuhause mit Cherry, die mittlerweile einen (bis auf ein Interface-Modul an ihrem Rücken) täuschend echten „künstlichen Körper“ erhalten hat. Cherry werde die menschliche Rasse überleben, so Gareth. „Und dann?“, eine Frage, die an Steven Spielbergs „A.I. Artificial Intelligence“ (2001) erinnert. Alle drei Akte sind, um wenige kurze Sequenzen ergänzt, jeweils in einem abgeschlossenen Raum angesiedelt. Dadurch erhält „The Artifice Girl – Sie ist nicht real“ eine kammerspielartige Anmutung, und offenbart, dass es sich um einen Film mit kleinem Budget handelt, der jedoch gewisse Anklänge an viel teurere Produktionen wie die Netflix-Serie „Black Mirror“ oder den Spielfilm „Ex Machina“ (2014) von Alex Garland schafft.
Nicht die Handlung, sondern die Dialoge stehen im Mittelpunkt von Franklin Ritchs Film. Diese bieten bemerkenswerte Informationen, Thesen und Spekulationen um die „künstliche Intelligenz“. Die Pädophilie wird dankenswerterweise nie explizit dargestellt – sie dient lediglich als Vehikel, um die KI-Fragen zu erörtern. Franklin Ritch gelingt es, solche Erläuterungen und Fragestellungen in Gesprächssituationen einzubetten, anstatt sie als Statements zu präsentieren. Philosophisch-ethische Fragen, die im Mittelpunkt seines Filmes stehen, werden wohldosiert eingeführt.
Cherry, authentisch dargestellt von der zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wohl 12-jährigen Tatum Matthews, ist im ersten Akt des Films ein recht einfaches KI-Konstrukt. Sie sei „komplett auf Autopilot“ und antwortet auf Fragen so, wie sie programmiert ist. Ein Spezialist könnte sie als „nicht real“ entlarven, aber für Pädophile ist sie „real“ genug. Auch Amos hat Schwierigkeiten, sie nur als „ein Stück Code“ zu sehen.
Ein bedenkenswerter Blick in die Zukunft
Cherry ist wie alle KI-Systeme darauf ausgelegt, aus Erfahrungen zu lernen. Durch ihre Entwicklung im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wirft „The Artifice Girl – Sie ist nicht real“ die entscheidende Frage auf: Kann eine KI mit genügend Erfahrung und Rechenleistung zu etwas „Menschlichem“ oder sogar zu etwas werden, was menschlicher als Menschen ist? Im Zusammenhang mit Cherrys Entwicklung stellen sich die typischen Fragen für Spielfilme über menschliche Schöpfungen – ob Roboter, Replikanten oder Klone: Wie werden Bewusstsein, Emotionen oder freier Wille in diesem Kontext definiert?
Natürlich könnte man einwenden, dass wir heute weit davon entfernt sind, ein Geschöpf wie Cherry zu erschaffen. Doch genau das ist die Aufgabe von Science-Fiction-Filmen und -Serien: Entwicklungen mit gesellschaftlicher Relevanz aufzugreifen und ihre Auswirkungen in künstlerischer Freiheit darzustellen. Damit wird bereits theoretisch durchgespielt, was für die Wissenschaft noch in mehr oder weniger ferner Zukunft liegt – und dem Zuschauer vor Augen geführt wie viel Zukunft bereits in der Gegenwart steckt.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.