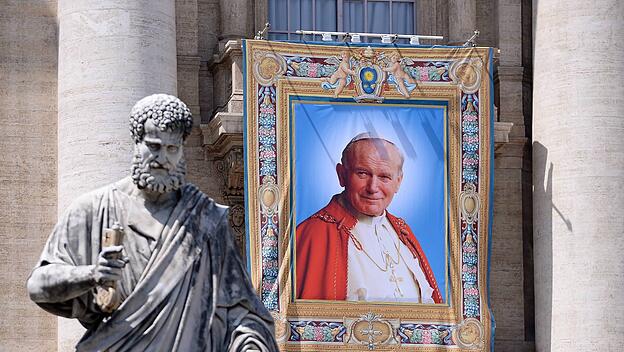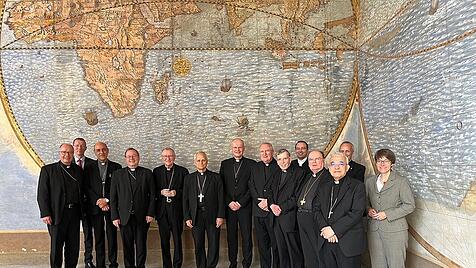Um die katholische Kirche in Deutschland ist es nicht gut bestellt. Mehr als tausend Mitglieder kehren ihr täglich den Rücken. Die Finanzlage wird schwieriger. Die „metaphysische Obdachlosigkeit“ (Joachim Meisner) derer, die die Kirche verlassen, scheint kein Thema zu sein. Die zerstrittene Bischofskonferenz sucht Antworten auf (vorgebliche) weltkirchliche Fragen. Dagegen bleiben „nationale“ Herausforderungen außen vor – wie die Neuevangelisierung, die schon Papst Johannes Paul II. anmahnte. Glaubens- und kirchentreue Katholiken, für die „Rom“ das Zentrum der Kirche ist, sind hierzulande längst innerkirchliche Exoten.
Der Missbrauchskandal hat einen Prozess beschleunigt, in dem die Kirche ihre „Orientierungskraft in der Gesellschaft“ (Daniel Deckers) zunehmend verliert. So veröffentlichte eine „Expertenkommission“ der Bundesregierung Thesen „zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin“, die im Widerspruch zur Kirche und zu ihrem Einsatz für das menschliche Leben stehen. Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) war nicht einmal mehr zur Mitwirkung eingeladen. Ein lang geratenes „Wort der deutschen Bischöfe“ zum Thema „Frieden“ blieb Anfang 2024 ohne nennenswerte außerkirchliche Reaktion. Just in dieser Situation haben die deutschen Bischöfe nun das Ende der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle (KSZ) in Mönchengladbach verfügt, eines Instituts, das gerade zu den erwähnten Themen über Jahrzehnte exzellente Arbeit geleistet hat. Selbst diejenigen bestreiten das nicht, die jetzt für ihr Ende verantwortlich sind.
Die KSZ geht zurück auf die frühen 1960er Jahre. Auch sie waren, wie unsere Tage, durch Unsicherheiten und Veränderungen geprägt. Joseph Höffner, gerade Bischof von Münster geworden und zuvor Ordinarius für Christliche Gesellschaftslehre, stellte eine „Kultur- und Lebenskrise“ fest. Daher, so erkannte er, bedürfe es, über das Wirken der vorhandenen Lehrstühle und Institutionen hinaus, neuer Wege. Einen solchen sah er in einer eigenständigen wissenschaftlichen Zentralstelle, die für die Bischofskonferenz Beiträge zur Analyse und Bewältigung dieser Krise liefern sollte.
Aktive Stimme in Politik und Gesellschaft
Einstimmig beschlossen die Bischöfe 1963, die KSZ in Mönchengladbach zu begründen, einst Sitz des „Volksvereins für das katholische Deutschland“. Nahezu eine Million Mitglieder stark, hatte er wesentlich zur kulturellen, politischen und sozialen Emanzipation der deutschen Katholiken beigetragen. Die Nationalsozialisten lösten ihn bereits 1933 auf. Die Stadtbibliothek Mönchengladbach übernahm die fast 100.000 Bände zählende Bibliothek des „Volksvereins“ und bewahrte sie so vor der Vernichtung. Der von den Bischöfen gewählte Standort hatte also eine hohe symbolische Bedeutung. Träger der KSZ war ein Verein nach bürgerlichem Recht, in dem die Mitglieder der Sozialkommission der Bischofskonferenz über die Mehrheit verfügten. Auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken wirkte mit. Anton Rauscher, von 1971 bis 1996 Ordinarius für Christliche Gesellschaftslehre an der Universität Augsburg, übernahm noch 1963 die Leitung von dem plötzlich verstorbenen Gründungsdirektor Gustav Gundlach. 2010 folgte Peter Schallenberg, Professor für Moraltheologie und Ethik an der Theologischen Fakultät Paderborn.
Von Beginn an entwickelte die KSZ vielfältige und akzentuierte Aktivitäten. Sie beteiligte sich an der internationalen Friedensdiskussion, suchte den wissenschaftlichen Dialog mit US-Universitäten und den Austausch mit Südkorea. Veranstaltungen zu gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Entwicklungen, zur sozialen Gerechtigkeit, Menschenrechten oder der Theologie der Befreiung fanden statt. Regelmäßige Teilnehmer waren Kardinäle und Minister, desgleichen polnische Oppositionelle, die später zur friedlichen Revolution beitrugen. Hinzu kam die Grundlagenarbeit im Bereich der Katholizismus-Forschung. Aufsehen erregte der Entwurf eines Hirtenbriefs zur Bundestagswahl 1980, in dem Kritik an der Politik der Bundesregierung beim Schwangerschaftsabbruch sowie bei der Staatsverschuldung geübt wurde. Das dahinter stehende Grundproblem – Erhaltung der Lebenschancen künftiger Generationen – ist heute so aktuell wie damals.
Die „Grüne Reihe“ wurde zum Markenzeichen
Die exemplarisch aufgeführten Aktivitäten und Themenfelder fanden großes Interesse. Etwa 100 Berichtsbände, Monografien und Dokumentationen belegen Engagement und Effizienz der KSZ. Ihr „Markenzeichen“ war die „Grüne Reihe“, in der bis 2024 mehr als 500 Ausgaben erschienen. Die Themen umfassten die ganze Bandbreite der Institutsarbeit. Einzelne Ausgaben erreichten eine Auflage von bis zu 70.000 Exemplaren.
Der Wechsel in der Leitung 2010 sollte, so hieß es, auch dabei helfen, die inzwischen konkurrierenden Richtungen des Faches Christliche Gesellschaftslehre „zusammenzuführen“. Das gelang nur bedingt, wozu auch die unterschiedliche Nähe zum kirchlichen Lehramt beitrug. Die letzte Sitzung dieses eigens gebildeten „Beirats“ fand 2016 statt. Erschwert wurde die Situation durch finanzielle Belastungen, lag doch der jährliche Zuschuss der Bischöfe seit Jahrzehnten unverändert bei 376.000 Euro. Angesichts steigender Personal- und Sachkosten bedeutete das eine dramatische Kürzung. Ein Ausgleich durch Drittmittel gelang immer weniger.
Desinteresse seitens der Bischöfe
Kritik an der Arbeit der KSZ oder ihrer Leitung wurde von bischöflicher Seite nicht geäußert, vielmehr der Leiter nach 2010 mehrfach wiedergewählt. Gleichwohl beschloss die zuständige Kommission VI der DBK im September 2023 nach sitzungsinternen Diskussionen eine Empfehlung, die Zahlungen an die KSZ zum Jahresende 2024 einzustellen und die von ihr genutzte Liegenschaft zu veräußern. Der Trägerverein wurde über diese Absicht nicht unterrichtet, geschweige denn in die Beschlussfassung einbezogen. Wie dieses Verfahren in eine „synodale“ Zeit passt, bleibt das Geheimnis der Bischöfe. Mehr noch: Die Kommission hielt auch ihren eigenen Beraterkreis außen vor.
Seit vielen Jahren hatte kein einziger der Bischöfe, die der Kommission VI angehören und somit geborene Mitglieder des Trägervereins der KSZ sind, an einer Sitzung teilgenommen. Sie ließen sich regelmäßig durch Referenten der DBK vertreten, denen, so hatte es den Anschein, keinerlei inhaltliche Vorgaben auferlegt wurden. Dementsprechend entschieden ihre Berichte über die Arbeit und Existenz einer wissenschaftlichen Einrichtung und das Schicksal ihrer Mitarbeiter.
Ein persönliches Bild haben sich die Bischöfe selbst vor der Entscheidung zur Auflösung nicht gemacht. Der Bürokratie ging es wohl nur darum, Einsparungen um jeden Preis zu erzielen.
Bevor der Trägerverein zusammentrat, um die erzwungene Selbstauflösung zu vollziehen, gaben Mitglieder eine Erklärung ab: Sie betonte die Leistungen der KSZ, hob aber vor allem Herausforderungen hervor, denen sich die Bischöfe gegenübersähen und zu deren Bewältigung die KSZ wertvolle Beiträge leisten könne - die ungewisse Zukunft des Sozialstaats vor dem Hintergrund kontroverser Diskussionen und des demografischen Wandels genannt, die Aushöhlung des grundgesetzlichen Schutzes von Ehe und Familie sowie des Lebensschutzes und die absehbaren Veränderungen des Staatskirchenrechts, die letztlich auf die Existenz der Kirche zielten. Die Bischöfe antworteten nicht. Die Erklärung hat aber dazu beigetragen, dass die Mitgliederversammlung des Trägervereins verschoben wurde. Als sie schließlich im April 2024 stattfand, nahm nur der Vorsitzende der Kommission VI, Bischof Wilmer, teil – wenigstens elektronisch. Alle übrigen Bischöfe verzichteten auch jetzt darauf, Flagge zu zeigen.
Viele Fragen, keine Antworten
In der Sitzung wurden die Bischöfe beziehungsweise ihre Mitarbeiter aus dem Sekretariat mit inhaltlichen Fragen konfrontiert, so nach einer Evaluation, wie sie bei wissenschaftlichen Instituten selbstverständlich ist, nach grundsätzlicher oder praktischer Kritik an der Arbeit der KSZ oder ihrer Leitung und schließlich nach der Urheberschaft der Vorlage, die zu dem Beschluss der Kommission VI geführt hat. Auf keine dieser Fragen gab es eine Antwort – ein Vorgang, der für sich spricht.
Der Trägerverein beschloss, wie von langer Hand geplant, mit seiner bischöflichen Mehrheit die Auflösung zum 31. Dezember 2024. In der Konsequenz muss die KSZ Projekte abbrechen, für die sie Drittmittel eingeworben und zum Teil bereits verausgabt hat. Dazu gehörten auch die Förderung des ökumenischen Dialogs mit der ukrainischen Orthodoxie zur Friedensethik und zur Friedensarbeit – eine der wenigen Möglichkeiten, dort perspektivisch zum Frieden beizutragen. Der Abbruch dieser Projekte dürfte kaum geeignet sein, außerkirchliche Geldgeber für künftige Zuwendungen an katholische Einrichtungen zu gewinnen.
In einer Presseerklärung der DBK zum Ende der KSZ hieß es, die Pluralisierung „der katholischen und sozialwissenschaftlichen Fragestellungen“ finde an unterschiedlichen Orten statt, so dass es einer Zentralstelle nicht bedürfe. Joseph Höffner war da schon vor mehr als 60 Jahren weitsichtiger. Auch die „Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik“, ein Zusammenschluss von Professorinnen und Professoren für Sozialethik an den deutschsprachigen Hochschulen, bedauerte die Auflösung der KSZ – und widerlegte damit die kenntnisarme Verlautbarung der Bischofskonferenz. Das Ende der KSZ ist beschlossen. Die gesellschaftliche, politische und kirchliche Situation wird von den Verantwortlichen offensichtlich so eingeschätzt, dass es fachlich fundierter und zugleich kirchentreuer Beratung nicht bedarf. In der Politik oder der Wirtschaft würden schlechte Bilanzen bei gleichzeitigem Verzicht auf qualifizierte Beratung personelle Konsequenzen nach sich ziehen. Kirchliche Kreise in Deutschland zeigen, allerdings im schlechten Sinne, dass sie nicht von dieser Welt sind.
Der Autor, Staatssekretär a. D., ist Historiker und ad personam berufenes Mitglied des Trägervereins der KSZ seit 2009.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.