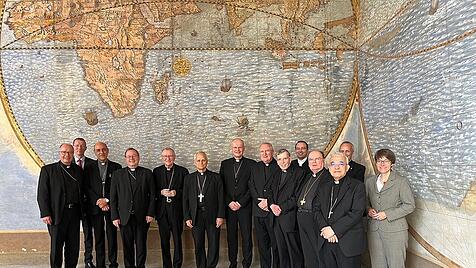Vor 30 Jahren erklärten die Vereinten Nationen das Jahr 1994 zum Internationalen Jahr der Familie. Ziel war es, das globale Bewusstsein für die Bedeutung der Familie für die Gesellschaft zu schärfen. Jedes Jahr wird seither der 15. Mai als internationaler Tag der Familie gefeiert – mehr oder weniger beachtet von Politik und Öffentlichkeit. Die österreichische Familienministerin Susanne Raab nahm vergangene Woche das Jubiläumsjahr zum Anlass, zu einer großen Konferenz der europäischen Familienminister nach Wien zu laden. Zwölf europäische Länder (Belgien, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Malta, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn und Zypern) folgten der Einladung und schickten Angehörige ihrer Familienministerien, um eine gemeinsame Deklaration für ein familienfreundliches Europa zu unterzeichnen.
Die deutsche Bundesfamilienministerin Lisa Paus ließ sich vertreten durch Staatssekretärin Ekin Deligöz. Diese stellte in Wien familienpolitische Maßnahmen Deutschlands wie beispielsweise die geplante Grundsicherung für Kinder und den Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder“ vor.
Wie die österreichische Familienministerin betonte, möchte sie mit dieser Initiative eine gemeinsame Plattform für ein familienfreundliches Europa schaffen, auch weil es kein eigenes Familienressort auf EU-Ebene gebe. Es gehe ihr darum, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in ganz Europa weiter zu fördern, sowie mehr Bewusstsein für familienfreundliche Maßnahme auf internationaler Ebene zu schaffen. Sie sei überzeugt, dass starke Familien die Voraussetzung für ein zukunftsfähiges Europa sind, so Familienministerin Raab.
Bedeutung der Familie unbestritten
Auf die Familienkonferenz auf Ministerebene folgte eine Tagung über „die Bedeutung der Familie für die Gesellschaft“, an der Vertreter von Familienorganisationen, Behörden, der Wissenschaft und der Praxis teilnahmen. In ihren Grußworten betonte die Familienministerin, dass es neben allen finanziellen und infrastrukturellen Maßnahmen auch wichtig sei, zu sagen, dass es einfach schön und bereichernd sei, eine Familie zu gründen. Raab bezeichnete Österreich als Spitzen- und Vorreiter bei familienpolitischen Maßnahmen: Mit dem Mix aus finanzieller Unterstützung durch die Familienbeihilfe, die seit kurzem auch jährlich valorisiert wird, einer Steuerentlastung durch den Familienbonus und der Erweiterung von Sachleistungen seien Meilensteine in der Familienpolitik gelungen. Der flächendeckende Ausbau der Kinderbetreuung müsse forciert werden; dabei dürfe Wahlfreiheit nicht nur ein Slogan sein: Selbstverständlich müsse es möglich sein, dass Kinder zu Hause betreut werden.
In dem anschließenden Vortrag ging die deutsche Soziologin Karin Jurczyk auf die Vielfalt privater Lebensformen ein und wies darauf hin, dass es nicht mehr selbstverständlich sei, eine eigene Familie zu gründen. Heute müsse man „Familie tun“: Der Begriff „Doing Family“ bedeute, so die Wissenschaftlerin, dass Familien keine gegebenen Ressourcen mehr seien und nicht mehr an Ehe, Blutsverwandtschaft und Naturhaftigkeit gebunden seien. Historisch gesehen habe es die männliche Ernährerfamilie „nur“ zwischen 1945-1970 gegeben. Diese sei gekennzeichnet gewesen durch mehrere Kinder, einen gemeinsamen Haushalt, die Trennung zwischen Erwerbs- und Familienleben sowie eine hierarchische Geschlechterbeziehung. Diese „Normfamilie“, so die Soziologin, schwirre noch immer in den Köpfen herum, obwohl diese ihre Selbstverständlichkeit längst verloren habe. Jurczyk sieht Familie als offene und reflexive Gemeinschaft, die sich an den Begriffen Sorgebeziehungen, Verlässlichkeit und Transgenerationalität orientiere. Sie kommt zum Schluss, dass Familie zwar privat organisiert werde, aber eine gesellschaftliche Angelegenheit sei und dass zeitgemäße Familienpolitik Sorgebeziehungen und nicht Lebensformen zum Ankerpunkt machen dürfe.
Anforderungen an die Eltern steigen
Die Wiener Familiensoziologin Ulrike Zartler erläuterte, dass der Stellenwert der Familie unverändert hoch sei. 90 Prozent der österreichischen Bevölkerung halte demnach Familie für einen wesentlichen Glücksfaktor. Die Rahmenbedingungen hätten sich aber verändert: Eheschließungen erfolgten seltener und später. Die nichtehelichen Lebensgemeinschaften sind in Österreich von 7,6 Prozent (1995) auf 17,7 Prozent im Jahr 2022 gestiegen, so die Familienexpertin. Mehr als die Hälfte aller Erstgeborenen haben demnach unverheiratete Eltern. Allerdings erfolge in mehr als zwei von fünf Fällen eine Eheschließung der Eltern bis zum sechsten Lebensjahr des Kindes, erklärt Zartler.
Zartler sieht auch große Veränderungen bei den Anforderungen an heutige Eltern. So stellt sie einen Trend zur Pädagogisierung und Professionalisierung von Elternschaft fest. Gleichzeitig fehle jedoch die Alltagserfahrung mit Kindern, da immer weniger Kinder geboren werden. Auch beobachtet Zartler einen Wandel in der Erziehung: Bis in die 1960er Jahre hätten Eltern ihren Kindern befohlen, dann folgte bis zur Jahrtausendwende ein Trend zum Verhandeln, der dann vom Beraten abgelöst wurde. Mütter und Väter sieht Zartler heute mit überhöhten Erwartungen konfrontiert, die meist von den Alltagserfahrungen beider abweichen: So müsse eine „glückliche“ Mutter heute gleichzeitig berufstätig, dem Kind zugewandt sein und eine erfolgreiche kindliche Entwicklung sichern. Nicht viel besser gehe es den Vätern, die Care-Arbeit übernehmen sollen und gleichzeitig mit strukturellen Zwängen bei der Erwerbsarbeit zu kämpfen haben.
Abschließend ging die Wirtschaftswissenschaftlerin Margit Schratzenstaller auf die ökonomische Bedeutung von Familien für die Gesellschaft ein und betonte, dass das Humankapital einen unverzichtbaren Wert für den Sozialstaat darstelle. Sie bezifferte den Wert der unbezahlten Arbeit, der in Familien geleistet wird, bei einem österreichischen Bruttoinlandsprodukt von 447 Milliarden Euro mit 100 Milliarden Euro. 64 Prozent davon würden wenig überraschend von Frauen geleistet. Schratzenstaller beklagte in ihrem Vortrag auch die eingeschränkte Chancengleichheit durch Vererbung sozialer Ungleichheit. So besuchten nur 9,4 Prozent der Jugendlichen, deren Eltern lediglich einen Pflichtschulabschluss haben, eine Hochschule. Im Gegensatz dazu fänden 61,3 Prozent der Akademikerkinder den Weg auf die Universität.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.