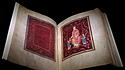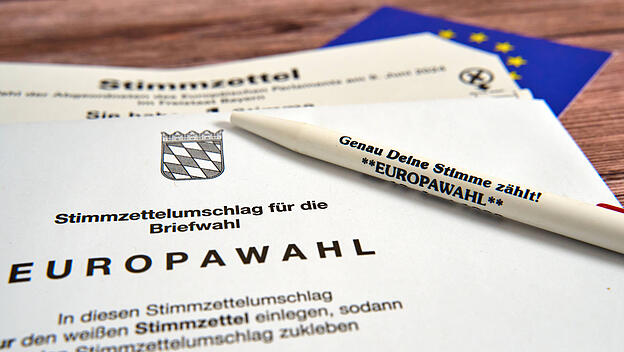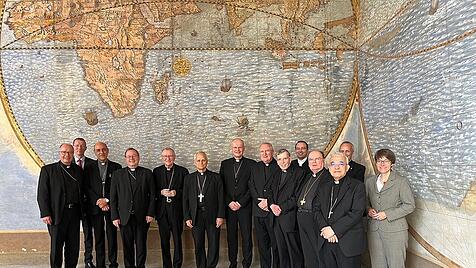Uns ist in alten mæren wunders vil geseit / von helden lobebæren, von grôzer arebeit, / von fröuden hôchgezîten, von weinen und von klagen, / von küener recken strîten muget ir nu wunder hœren sagen.“ Auch wer kein Mittelhochdeutsch beherrscht, kann diese Zeilen vermutlich zuordnen: Es ist der Beginn des „Nibelungenlieds“, das bekanntlich die in einem riesigen Blutbad endende Geschichte von Siegfried, dem Drachentöter, dem sagenhaften Nibelungenhort, der schönen Kriemhild, dem Meuchelmörder Hagen und den Burgunderkönigen in Worms erzählt. Der heute bekannte Text wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts auf Mittelhochdeutsch niedergeschrieben, aber der zur Nibelungensage gehörende Stoff ist wesentlich älter und reicht bis in die Zeit der Völkerwanderung (viertes bis sechstes Jahrhundert) zurück, auch als Heldenalter oder heroisches Zeitalter bekannt.
Das „Nibelungenlied“ gilt als deutsches Nationalepos schlechthin – eben mit dem Drachentöter Siegfried als deutschem Nationalhelden im Mittelpunkt. Und wer auf den Spuren Siegfrieds wandeln will, reist dafür nach Xanten am Niederrhein nahe der deutsch-niederländischen Grenze in Nordrhein-Westfalen. Dieses historische Städtchen ist zwar vor allem für den LVR-Archäologischen Park Xanten bekannt, der auf den Überresten der römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana steht – aber sie ist gleichsam eng mit der Sage von Siegfried verbunden, auch wenn dies heute kaum noch zum allgemeinen kulturellen Wissen gehört.
Nicht nur für ein elitäres Publikum
„Laut der Sage wurde Siegfried, der zentrale Held des Nibelungenlieds, in Xanten geboren und wuchs dort auf. Die Stadt wird als sein Heimatort genannt. Diese Verbindung hat Xanten zu einem wichtigen Ort für die kulturelle Erinnerung und das kulturelle Erbe rund um die Nibelungensage gemacht“, sagt die Mediävistin Anke Lyttwin. Sie muss es wissen, schließlich leitet sie seit zwölf Jahren das Siegfried-Museum der Stadt, das sich seit der Gründung als Nibelungenhort 2010 als Erinnerungsraum für den Nibelungenmythos und die Nibelungenrezeption etabliert hat und jedes Jahr eine hohe vierstellige Zahl an Besuchern anzieht.
„In den wichtigsten Handschriften des Nibelungenlieds liegt die Heimat des Helden Siegfried in Xanten, daher war es die Intention zur Gründung des Nibelungenmuseums, die Verbindung Xantens mit dem Nibelungenlied deutlicher herauszustellen“, betont die Museumsleitung. Dies geht zurück auf die Idee, einen „Geschichts- und Erlebnisraum Xanten“ durch den Nibelungenbezug zu erweitern. „Beim Museumskonzept herrschte Einigkeit, dass die Rezeptionsgeschichte und damit die Entstehung des Mythos inklusive seiner Schattenseite im Vordergrund stehen sollte. Man verwarf die Idee eines reinen Literaturmuseums wahrscheinlich aus Mangel an Objekten und Attraktivität, denn Literatur ist eine immaterielle Kunstform, die hauptsächlich ein elitäres Publikum ansprechen würde. Die Entstehung des Mythos und die Rezeptionsgeschichte in all ihren Facetten spricht viel mehr Menschen an.“
Das Museum befindet sich im Zentrum der historischen Altstadt, im Schatten des St. Viktor geweihten Domes. Auf zum Teil überbauten historischen Gebäuderesten beherbergt das Museum Ausstellungsstücke aus 600 Jahren Nibelungenrezeption und zeigt ein dramatisches Bild jeder einzelnen Epoche. Im Eingangsbereich sind Reste der altehrwürdigen Bischofsburg zu entdecken. Vom rekonstruierten Mitteltor führt ein historischer Verbindungsgang zum mächtigen Meerturm, der ursprünglich zur spätmittelalterlichen Stadtbefestigung gehörte und als Gefängnis diente.
Patriotische Vereinnahmung
Für die Germanistin und Buchwissenschaftlerin steht fest: „Es braucht ein Nibelungenmuseum, um die vielen verschiedenen Facetten des Nibelungenmythos aufzuzeigen, der wie der sagenhafte Nibelungenhort eine verfluchte und eine schillernde Seite hat. Die Faszination Nibelungen ist ungebrochen, zahlreiche Adaptionen und transmediale Überarbeitungen des Nibelungenstoffes sprechen dafür. Diese Bandbreite soll im Museum abgebildet werden und individuelle Zugänge schaffen. Selektive Wahrnehmung kann aber auch problematisch sein. Hier sehe ich den Bildungsauftrag, die Konstruktion des Mythos Nibelungen aufzuzeigen.“
Damit berührt Anke Lyttwin einen wesentlichen Punkt der heutigen Nibelungenrezeption, der nicht unerwähnt bleiben kann: Nach der politischen Instrumentalisierung und propagiertem Heldenkult im wilhelminischen Kaiserreich und der NS-Zeit, sei vor allem die Siegfriedfigur nicht unbelastet. Daher stelle sich immer wieder die Frage, wie man Germanenrezeption museal vermitteln kann, ohne in identitäts- beziehungsweise kulturpolitische Fallstricke zu geraten. Für sie gelte, eine klare Position zu beziehen, um vor allem die „patriotische Vereinnahmung zu erklären. Gerade die Siegfriedfigur hat durch den politischen Missbrauch enorm gelitten. Aus diesen Gründen verbietet es sich, einen unkritischen Erinnerungsraum zu schaffen“, sagt Anke Lyttwin.
Der Einfluss Richard Wagners
Die Ausstellung bietet in ihrem Konzept als historisch-kulturelle Zeitreise verschiedene Themenwelten rund um das Nibelungenlied und das höfische Leben des Hochmittelalters. Angefangen mit zahlreichen Objekten zum Thema Buchkunst – etwa eine Faksimilehandschrift des Nibelungenliedes – über eine rekonstruierte Rüstkammer bis hin zum Komplex „Spiel und Kurzweil“ erleben die Besucher die Faszination des mittelalterlichen Epos bis heute, was sich an der Darstellung der Nibelungen auf Theaterbühnen, Kinoleinwänden, in Comics und auf opulenten Wandgemälden des 19. Jahrhunderts zeigt.
Und nicht zuletzt spielt wohl der bedeutendste Interpret der Nibelungensage eine große Rolle: Richard Wagner. Anke Lyttwin ist es gelungen, durch zahlreiche Exponate die mythologische Bedeutung der Nibelungen für Richard Wagner und seine Bombast-Oper „Der Ring des Nibelungen“ herauszuarbeiten und gleichzeitig einen Einblick zu geben, wie Richard Wagner das Germanenbild bis heute prägt. „Carl Emil Doepler, ein deutscher Maler, Buchillustrator und Kostümbildner, hat für die Uraufführung des ,Ring der Nibelungen' bei den ersten Bayreuther Festspielen im Jahr 1876 das Bühnenbild und die Kostüme entworfen und Siegfried und anderen Figuren in seinen Augen typische germanische Kostüme verpasst: mit Flügelhelm, Vollbart und Fellumhang. Daher stammt unser heutiges Bild der Germanen als kühne, hünenhafte, freiheitsliebende, rotblonde Krieger, was nichts anderes als eine romantisch-nationalistische Konstruktion ist.“
Mit diesen Klischees rund um das „Nibelungenlied“ und die damit verbundenen Sagenkreise will das Siegfried-Museum aufräumen und zugleich den Zauber und die Schönheit der mittelalterlichen Dichtung vermitteln. Das ist der Wert dieses Hauses, das damit weit über die Präsentation der lokalen Legende Siegfried von Xanten hinausgeht.
SiegfriedMuseum Xanten
Kurfürstenstraße 9, 46509 Xanten
www.siegfriedmuseum-xanten.de
Öffnungszeiten (auch an Feiertagen):
Montag bis Samstag 10 bis 17 Uhr und Sonntag 10 bis 16 Uhr
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.