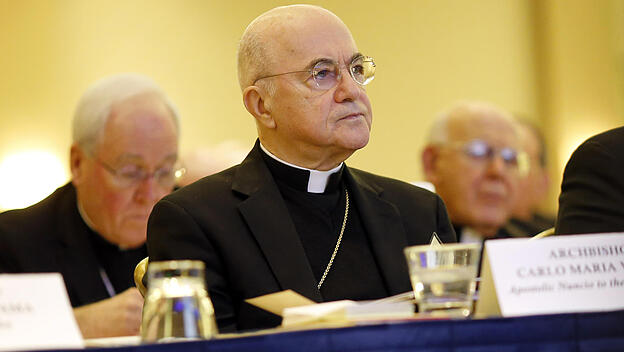Was hinter dem Wortspiel „Göttinnen und Gattinnen“ steckt, erläutert ein einführender Text der Ausstellung: „Die Hälfte der olympischen Gottheiten sind mächtige Göttinnen. Viele andere mythische Frauen aber sind weniger bekannt und wurden lange vor allem als Gattinnen oder Geliebte der großen Götter und Helden wahrgenommen. Dies hat auch damit zu tun, dass die antiken Quellen aus männlicher Perspektive berichten.“
Die von Annegret Klünker, der wissenschaftlichen Museumsassistentin der Berliner Antikensammlung kuratierte Ausstellung möchte einen „neuen Blick auf die Göttinnen und Heldinnen“ werfen. Eine gewisse Inspiration dazu stammt aus dem Boom aktueller Lesarten der Mythen. Seit Jahren werden nicht nur historische Abhandlungen zum Thema „Frauen in der Antike“ veröffentlicht. Die antiken Heldinnen bevölkern auch beliebte Romane, „Graphic Novels“ und ähnliche Publikationen für Jugendliche und Erwachsene. Meistens sind es Autorinnen, die den mythischen Frauengestalten eine eigene Stimme geben.
„Göttinnen und Gattinnen“ bietet einen Einblick in die Vielfalt weiblicher Lebensformen sowie die Geschlechterordnungen der griechischen und römischen Kulturen. Solche Mythen wurden im Laufe der Geschichte entsprechend der jeweiligen Zeit anders interpretiert und der jeweiligen gesellschaftlichen Realität angepasst. So entsteht durch die moderne Beschäftigung weiblicher Autoren mit dieser Mythologie ein Perspektivwechsel auf Frauen wie Medusa, Aphrodite oder Penelope, die bislang vor allem durch Autoren der männlich geprägten antiken Gesellschaft als Stereotype weiblicher Rollenbilder überliefert sind: monströs wie Medusa, schön wie Aphrodite, treu wie Penelope.
Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen zwölf Frauengestalten, von den berühmtesten Göttinnen wie Aphrodite bis hin zu weniger bekannten Heldinnen wie Atalante. Die Darstellung der Frau in der Antike findet nicht nur mittels lebensgroßer Statuen statt, sondern auch in detaillierten Vasenbildern und kleinen Schmuckstücken. Solche Werke zeigen, wie man diese Frauen in der Antike darstellte und welche Geschichten ihre Bilder erzählen.
Klar definierte Geschlechterrollen
In den antiken Gesellschaften sowohl Griechenlands als auch Roms waren Geschlechtergrenzen und -rollen klar definiert, doch in den Mythen findet sich gelegentlich eine gewisse Abweichung von diesen Normen. Schrieben diese den Frauen Unterordnung zu, so halten sich die mythologischen Frauen nicht immer daran. Als herausragendes Beispiel widmet „Göttinnen und Gattinnen“ Hera (Juno), der Ehefrau des Göttervaters Zeus (Jupiter), eine eigene Vitrine. Als höchste Göttin und Gattin war sie zuständig für die Ehe. Die Menschen verehrten sie als ihre Beschützerin. Weil Zeus sie in verschiedenen Gestalten betrog – aus der Kunst ist besonders bekannt, wie Zeus sich als Schwan seiner Geliebten Leda näherte, so etwa in Leonardo da Vincis „Leda mit dem Schwan“ –, rächte sich Hera an den von Zeus überwältigten Frauen oder an deren gemeinsamen Kindern: Eines ihrer bekanntesten Opfer ist Herakles (Herkules), den sie mit besonderer Wut verfolgte. Einige verhalten sich „regelkonform“ und verkörpern Treue, Sittsamkeit und Fruchtbarkeit.
Wurden sie als „Vorbilder“ wahrgenommen? Oder gilt dies im Gegensatz dazu etwa von drei der am meisten verehrten Göttinnen – Athena, Aphrodite und Artemis –, die jede auf ihre Weise Normgrenzen überschreiten? Was bedeutet es, wenn die nackte Liebesgöttin Aphrodite ein Schwert trägt? Handeln die Frauen jedoch zu weit jenseits weiblicher Rollennormen, werden sie zu negativen Gegenbildern gesellschaftlichen Verhaltens. Ein bekanntes Beispiel ist Medusa. Doch war sie wirklich nur das „Monster“? Die Ausstellung zeigt über die antiken Objekte hinaus auch deutungsgeschichtliche und zeitgenössische Perspektiven. Medusa wurde beispielsweise ab den 1980er Jahren vom männermordenden Monster zu einem feministischen Vorbild.
Neben Medusa zeigt die Ausstellung zwei weitere mythologische Frauen, die zwar weitaus weniger bekannt sind, sich aber ebenso wenig regelkonform verhielten: Atalante wird als Kind von ihrem Vater ausgesetzt, weil er sich einen Sohn gewünscht hatte. Sie wächst bei Jägern auf, schließt sich Artemis‘ Gefolge an, und gelobt Jungfräulichkeit. Sie nimmt an eigentlich Männern vorbehaltenen Aktivitäten wie Ringkampf und Jagd teil. Durch Aphrodites Eingriff wird sie später doch noch verheiratet, was dramatische Folgen hat: Das Paar wird durch den Frevel in Löwen verwandelt.
Eine Umkehrung der Geschlechterrollen findet sich im Paar Omphale und Herakles. Als Strafe für einen Mord muss der Held der Königin Omphale drei Jahre lang als Sklave dienen und traditionelle Frauenarbeiten verrichten. Doch er verliebt sich in die Königin und übergibt ihr sein Löwenfell und seine Keule. Nun trägt Omphale die Zeichen seiner Kraft. Dass viele Römerinnen sich als Omphale darstellen ließen, stellt jedoch die Vorstellung einer männerdominierten Gesellschaft, welche die Frau unterdrückte, teilweise infrage.
„Göttinnen und Gattinnen“ erlaubt einen aktuellen Blick auf eine Reihe von mythologischen Frauen der griechischen und römischen Antike. Vor allem deren Neuinterpretation trägt zur Aktualität der Bilder bei.
„Göttinnen und Gattinnen“, Altes Museum Berlin. Bis 15. März 2025.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.