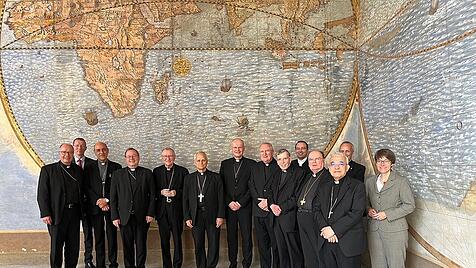Kulturen sind lebendige Organismen und durchschreiten, wie jedes Lebewesen, einen natürlichen Lebensweg, der von der Entstehung über die Blüte und Fülle bis hin zu Verfall und Tod führt. So zumindest lautet eine der zentralen Thesen des Geschichtsphilosophen Oswald Spengler. In seinem zweibändigen geschichts- und kulturphilosophischen Klassiker „Der Untergang des Abendlandes“ (1918/1922) war Spengler zudem der Überzeugung, dass die Lebenskräfte der europäisch-abendländischen Kultur aufgebraucht seien: Ihr Lebenszyklus stehe vor der Vollendung, der Niedergang habe unwiderruflich begonnen.
Nun muss man Spengler in seinen geschichtsphilosophischen Spekulationen nicht folgen. Als Christ wird man ihnen sogar in einem entscheidenden Punkt widersprechen müssen. Denn während Spengler meinte, in der Geschichte eine Abfolge in sich geschlossener kultureller Zyklen erkennen zu können, leben Christen in der Überzeugung, dass es einen einzigartigen Dreh- und Angelpunkt in der Geschichte gegeben hat: Der allmächtige Schöpfer des Universums, der Lenker aller weltlichen Geschicke, ist selbst als Mensch in die Weltgeschichte eingetreten, um aus ihr eine Heilsgeschichte zu machen.
Wer herrscht über die Geschichte?
Dass wir in Europa – oder allgemeiner gesprochen: im Westen – in Zeiten des institutionellen, sittlichen und religiösen Verfalls leben, lässt sich dennoch schwer leugnen. Das Christentum ist kulturell im Rückzug begriffen. Die Volkskirche ist entweder nur noch eine blasse Erinnerung an vergangene, bessere Tage oder ein frommer Zukunftswunsch jener, die noch am christlichen Glauben und seiner religiösen Praxis festhalten. Die Realität ist dagegen von Entchristlichung und Säkularisierung geprägt. Und dennoch dürfen sich Christen nicht in weinerlichen Klagen über den „Untergang des Abendlandes“ ergehen. Denn sie müssten wissen, dass nicht anonyme Mächte, eiserne Gesetzmäßigkeiten oder ein blindes Schicksal über den Gang der Geschichte herrschen, sondern der lebendige Gott. Dieser aber vermag auf für den Menschen völlig neue und unvorhergesehene Weise in der Welt zu wirken und den erwartbaren Lauf der Dinge zu ändern.
Wie also lässt sich eine christliche Zukunft Europas jenseits der üblichen Verfallsklagen denken? Welche Möglichkeiten der Re- und Neuchristianisierung – ¬oder zumindest einer Überwinterung des Christentums – sind nicht nur prinzipiell denkbar, sondern auch realistisch? Diesen und verwandten Fragen ist die neue „Tagespost“-Serie gewidmet, in der christliche Autoren und Intellektuelle ihre Überlegungen zu einem Aufbruch in eine christliche Zukunft Europas darlegen.
Das Verlangen nach Transzendenz in der Moderne
Den Anfang macht Johannes Hartl. In seinem Essay „Nach dem säkularen Zeitalter“ stellt er sich die Frage, wie das Christentum angesichts der beiden Megatrends der Moderne, nämlich Säkularisierung und Industrialisierung, lebendig und in der Welt wirksam bleiben kann. Die Antwort findet Hartl in der Tatsache, dass der Mensch von einem Verlangen nach Transzendenz und Sinn gekennzeichnet ist – einem Verlangen, das sich nicht durch weltliche Güter oder technische Errungenschaften stillen lässt.
Auch die Ausbreitung des Islams im Westen und die Bedrohungen, die damit für Christen entstehen, müssen kein Grund zur Verzweiflung sein. Wie Hartl mit Verweis auf die koptischen Christen Ägyptens zeigt, kann das Christentum gerade auch dort blühen, wo es in seiner Existenz besonders herausgefordert wird.
Den Essay von Johannes Hartl lesen Sie in der kommenden Ausgabe.