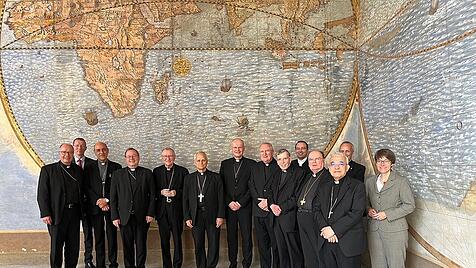Zwei profilierte katholische Hochschulen mit Standort in Niederösterreich rückten in der Vorwoche den 1885 in Verona geborenen und 1968 in München verstorbenen Theologen Romano Guardini in den Blick: die „Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz“ und die „Katholische Hochschule ITI“ im unweit gelegenen Trumau. Guardini wusste, „dass der Glaube die Vernunft formt“, sagte der Großkanzler der Heiligenkreuzer Hochschule, Zisterzienserabt Maximilian Heim, zur Begründung dieser Kooperation. Und der Vize-Rektor und Dekan des ITI, Michael Wladika, meinte, Guardini sei „einer der wenigen wichtigen und bleibenden Theologen des 20. Jahrhunderts“. „Nur wer Gott kennt, kennt den Menschen. Aber wer kennt Gott?“, fasste die Religionsphilosophin und Guardini-Biografin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz den Ansatz des Gelehrten zusammen. „Karl Rahner hat den anthropologischen Einstieg in die Theologie geschafft. Das kannte Romano Guardini, hat aber selbst den genau umgekehrten Weg gewagt.“ Er habe Gott als Kraft des Werdens erkannt, als den Lebendigen und den Anfang schlechthin.
Gott schafft nicht nur aus freier Liebe, sondern er schafft in der Erlösung aus dem Sünder einen Menschen, der ohne Schuld ist. Zwei Anfänge: „Die Erlösung ist größer als die Schöpfung“, so Gerl-Falkovitz. Der dritte Anfang geschehe in der Wiederkunft Christi, mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. „Wir sind erlöst und gehen auf den dritten Anfang zu: Als Erlöste haben wir uns in das Werk Gottes einzubringen.“ Christliche Existenz sei nicht einfach nur Dasein, sondern stets auch Wirken.
Guardinis Theologie sei nicht zuerst Anthropologie, denn es gehe ihm um den Vorrang der Initiative Gottes. „Im sich offenbarenden Gott wird sich der Mensch offenbar.“ Dieser Weg der Theologie von der Offenbarung her sei schwieriger, aber auf lange Sicht verheißungsvoller, so Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz am vergangenen Freitag in Heiligenkreuz.
Guardini schrieb: „Jemand wollte, dass ich sei.“ Jeder Anfang sei ein Anruf, ja angerufen zu sein sei der Sinn des Personseins. Wie umgekehrt Sünde eine empörte Endlichkeit gegen das Geschenktsein, gegen allen Dank sei: „Wir wollen keinen anderen Grund haben als uns selbst.“ Gott ist und wirkt beständig, setzt nach dem menschlichen Absturz einen neuen Anfang.
Der Mensch aber ist nach Guardini in die Mitverantwortung gerufen, als Mitarbeiter der Wahrheit. Zur Ebenbildlichkeit des Menschen gehöre, nicht Marionette zu sein, sondern frei und mitgestaltend: „Welt wird erst durch uns.“ So komme Gottes Macht eben nicht zerbrechend, sondern sie will als Liebe erkannt werden. „Der Mensch ist ein Entwurf auf etwas Ungeheueres hin“, schrieb Guardini. Und weiter: „Es gehört zur Größe der Gnade, dass sie unsere Mitwirkung wünscht.“
Er hoffte auf Blüte des Christlichen
Im Gespräch mit der „Tagespost“ meinte Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz in Trumau, Guardini sei ein Vordenker gewesen. Er habe gegen seine eigenen Zweifel, ob es noch einmal zu einer großen Blüte des Christlichen kommen könne, zur Zuversicht aufgerufen. Ihn trieb die Frage um, „ob nicht in all dieser Zerstörung und Verwirrung noch etwas neues Großes kommt, das wir nicht sehen können“. Er habe das Neue, das immer wieder aus Ruinen wächst, mehrfach beschrieben. Guardini habe Theologie von Gottes Offenbarung her gedacht. „Wenn man die anthropologische Wende zu stark macht, kommt man nicht mehr zur Offenbarung.“ Dann bleibe man im Raum des Religiösen, komme aber nicht bis zur Dreifaltigkeit und zur Inkarnation. „Aber wenn ich von der Offenbarung ausgehe, habe ich zwar Zumutungen ans Denken, aber im Zuhören verstehe ich, dass sie in sich schlüssig sind. Dadurch gewinne auch der Mensch eine neue Fülle.“ Das zeitlos Bleibende an Guardini sei seine Christologie. Die Auseinandersetzung mit der Gestalt Jesu bei Guardini sei auch für andere, etwa für Hans Urs von Balthasar, prägend gewesen. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz setzt sich auch für die Seligsprechung Romano Guardinis ein: „Ich glaube, dass er ein Heiliger war. Er hat eine unglaubliche Wirkung entfaltet, zwei oder drei Generationen deutscher Jugendlicher geprägt.“ Guardini könnte der siebte Patron Europas werden, so Gerl-Falkovitz gegenüber dieser Zeitung.
„Es gehört zur Größe der Gnade, dass sie
unsere Mitwirkung wünscht.“
In Erinnerung daran, dass Romano Guardini in Johannes dem Täufer, Sokrates und Buddha den hebräischen, den griechischen und den indischen Vorläufer Jesu Christi sah, schilderte ITI-Dekan Michael Wladika Sokrates als exemplarischen Menschen und eines der „wesentlichen Themen der abendländischen Geistesgeschichte“. Sokrates stehe für das Denken des Universalen, habe als erster das Allgemeine vom Einzelnen unterschieden. „Sobald man Allgemeines und Einzelnes unterscheidet, wird das Einzelne zur Illustration“, so der Philosophieprofessor Wladika. Jedes Ding habe einen Sinn über sich hinaus. Romano Guardini habe Sokrates als einen Vorläufer Christi und als „Schatten des Kommenden“ gesehen. In der Diskussion bekräftigte Wladika, dass der Kulturraum der Inkarnation nicht irrelevant und damit beliebig austauschbar gewesen sei. Es sei vielmehr „providenziell, dass der Platonismus die bei weitem präsenteste Denkrichtung zur Zeit Jesu in diesem Kulturraum war“.
„Leben ist Sprechen“
Der Heiligenkreuzer Zisterzienserpater Philemon Dollinger zeigte in seinem Vortrag in Trumau Romano Guardinis Verhältnis zur Sprache wie auch zur Sprachzerstörung unter den Nazis, als etwa genuin christliche Begriffe (wie Glaube, Wunder und Gott) instrumentalisiert und damit verfälscht wurden. Die Sprache sei ein Geschenk, trage aber darum auch den Charakter der Verantwortung. Zum Wesen der Sprache gehöre laut Guardini die dem Menschen eigene Erkenntnisfähigkeit, die dem Tier abgehe: „Das Kind lernt sprechen, indem es denken lernt.“ Dass alle Einsicht unter dem Maßstab der Wahrheit stehe, gebe dem menschlichen Sprechen eine einzigartige Bedeutung. „Leben ist sprechen“, schrieb Guardini. Der Mensch lebe im Sprechen: „Es gibt keine wortlosen Gedanken. Der Mensch lebt, indem er redet.“
Die Schlussfolgerung daraus ist jedoch: „Wer die Sprache verletzt, schädigt den Menschen selbst.“ Das geschehe in der Propaganda, die Macht und Erfolg über Wahrheit und Gerechtigkeit setze. Sprache sei das „Zutage-Treten der Wahrheit“, darum werde sie zerstört, wo sie in den Dienst der Propaganda gestellt wird. Pater Philemon Dollinger wies aber auch darauf hin, dass laut Guardini das Wort erst durch das Schweigen seine Ausdrucksenergie gewinne. Reden und Schweigen bildeten eine Ganzheit: Stille sei wesentlich für lebendiges Tun, denn erst das Schweigen ermögliche, in die Tiefe zu gehen. Man könne still sein, aber innerlich geschwätzig, wenn das Herz voll Lärm ist. Die Menschwerdung wie die Auferstehung Jesu dagegen seien im Stillen vor sich gegangen. Guardini schrieb: „Die Stille gehört zum Schönsten, was es überhaupt gibt: ein Raum des Lauschens.“
„Die Ebenbildlichkeit des Menschen ist die Voraussetzung dafür, dass Gott selbst Mensch werden kann.“
„In der Begegnung mit Christus bekommen wir eine Ahnung vom Paradies“, bilanzierte der Rektor der Katholischen Hochschule ITI, Bernhard Dolna, in Trumau den theologischen Ansatz Guardinis. Für diesen sei ein Bekehrungserlebnis im Jahre 1905 bestimmend für den Rest seines Lebens gewesen. Er habe seine Seele der Kirche gegeben, weil diese die Präzision der Wahrheit habe. „Wer Christus erkennen will, muss umkehren aus der Autonomie des eigenen Denkens und sich einen neuen Maßstab geben lassen, um das Ganze zu verstehen“, so Rektor Dolna. Ähnlich wie Gerl-Falkovitz zeigte der Exeget Dolna, dass Romano Guardinis Theologie von Gott selbst und von seiner Offenbarung her denkt: „Gott hat sich als Urbild des Menschen gewollt: Das ist die Voraussetzung für die Menschwerdung. Die Ebenbildlichkeit des Menschen ist die Voraussetzung dafür, dass Gott selbst Mensch werden kann.“
In Jesus trete Gott in die Endlichkeit ein und bleibe Mensch: „Jesu Menschlichkeit setzt sich zur Rechten Gottes. Gott, der Absolute, hat das Endliche in sich aufgenommen.“ Guardini habe es als „Kühnheit Gottes“ bezeichnet, den Menschen mit der Freiheit zum Bösen geschaffen zu haben. Denn das Böse sei der Widerspruch zum geschaffenen Endlichen. In ihrem zweiten Vortrag schilderte Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz Guardini als einen Konservativen „mit dem Blick nach vorne“. Ihm sei es nicht um den Untergang des Abendlands gegangen, „sondern um einen neuen Aufgang“. Gegen seine eigene Bitterkeit habe er formuliert: „Das Neue muss aus dem ungebändigt Chaotischen selbst kommen.“ Letztlich sei es ihm nicht darum gegangen, „eine schöne Welt bewahren zu wollen, die untergehen muss“, sondern um eine neue Kultur: „Wie kann man in der Masse Person sein?“ In einer Zeit, in der die kulturelle Selbstverständlichkeit des Christlichen abgelöst wird, habe Guardini für ein gänzlich existenzielles Vertrauen, für Treue und eine Unmittelbarkeit der Person zu Gott geworben.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.