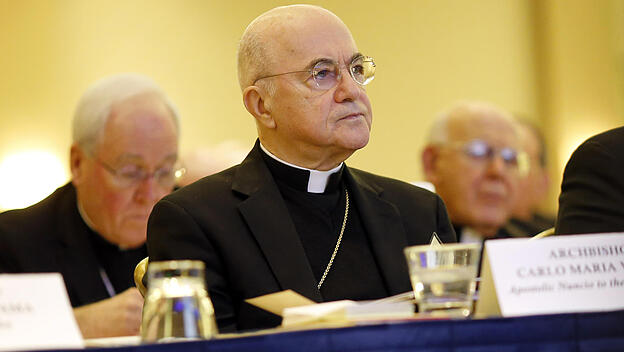Gottes Wort deutsch“ verbindet sich hierzulande und über unseren Sprachraum hinaus noch immer mit Martin Luther und seiner Übertragung der Bücher der Heiligen Schrift in die Sprache des Volkes, dem er zu diesem Zweck eifrig aufs Maul geschaut hatte. Aber der Reformator war keineswegs der erste, der den Versuch wagte, eine Übersetzung der Bibel vorzulegen. Im Rahmen des Langzeitprojekts „Der Österreichische Bibelübersetzer“ wird der Fokus auf eine bedeutende vorreformatorische Bibelübersetzung des 14. Jahrhunderts gelenkt. Sie basiert im Gegensatz zu der Martin Luthers, der den hebräischen und griechischen Text zugrunde legte, auf der lateinischen Vulgata, und bezieht überdies auch apokryphe Texte wie das Nikodemus-Evangelium sowie die im Mittelalter sehr beliebten Heiligenlegenden in die Kommentare zum Bibeltext mit ein.
Träger des Projektes, das im Jahre 2005 startete und dessen Laufzeit 2027 enden wird, ist die Bayerische Akademie der Wissenschaften. Deren an der Universität Augsburg verortete Arbeitsgruppe unter der Leitung des ehemaligen Ordinarius für Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters, Freimut Löser, wird sich in den kommenden zwölf Jahren der Erforschung und Veröffentlichung dieses Mammutprojektes widmen. Die Gruppe kooperiert mit einer weiteren Arbeitsgruppe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung zweier Professoren für Germanistische Mediävistik, Martin Schubert (Essen) und Jens Haustein (Jena). Die Vernetzung des Großprojektes mit der Berliner, der Münchener und der Augsburger Bibliothekenlandschaft ermöglicht den Wissenschaftlern den Zugriff auf ein Maximum an Ressourcen.
Der Österreichische Bibelübersetzer hat mit den drei Teilen seiner Arbeit, dem „Alttestamentlichen Werk“, dem „Evangelienwerk“ und dem „Psalmenkommentar“ 200 Jahre vor Martin Luther einen Großteil der Heiligen Schrift ins Deutsche übertragen. Aber auch seine weiteren theologischen Werke zu edieren und zu kommentieren ist Teil des in vier Projektphasen zu je drei Jahren gegliederten Forschungsprojektes. Das Ziel der Wissenschaftler ist eine vollständige Edition in gedruckter wie auch digitaler Form, die, wie es der Intention des Österreichischen Bibelübersetzers entsprach, allgemein zugänglich sein wird. Für den ersten Teil des Projekts ist dies dank der Förderung durch die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) für das „Alttestamentliche Werk“ bereits der Fall, es ist im Juli 2023 erschienen. Auch die digitalisierten Endprodukte und Transkriptionen aller Handschriften sowie des Editionstextes für „Das Evangelienwerk“ wurden seit Dezember 2022 auf www.bibeluebersetzer.de sukzessive zugänglich gemacht.
Das Werk eines unordinierten Laien
Natürlich wird das Langzeitprojekt nicht nur die Texte editieren. Es geht den Forschern auch darum, die Entstehungsbedingungen und die Rezeptionsgeschichte dieses bedeutenden Werkes zu erforschen und die Ergebnisse ihrer Arbeit rund um das Thema Bibelübersetzungen zum Teil des wissenschaftlichen Diskurses werden zu lassen. Dieses Projekt ist nicht nur wichtig, weil es dank der allgemein zugänglichen Digitalfassungen jedem ermöglicht, den Text selbst ebenso zu studieren wie die Forschungsergebnisse. Es wirft auch einen neuen Blick auf das Thema Verkündigung. Denn das Wirken des anonym gebliebenen Bibelübersetzers ist das Werk eines Mannes, der sich selbst als ungelernten Laien bezeichnet hat und nicht ordiniert war. Ein interessantes Faktum, denn dass im 14. Jahrhundert ein nicht durch formales Studium theologisch gebildeter Laie dafür sorgte, dass „die heilige Schrift den seligen krissten wirt geöffnet“ spricht von einer besonderen Sehnsucht nach Zugang zum Wort des Lebens, das aber auch auf ein breiteres Echo in den Gemeinden gestoßen sein muss.
Bemerkenswert ist überdies die Einbettung des Übersetzungswerkes in die apologetischen Schriften des Verfassers. Ganz ähnlich wie die Kirchenväter hatte auch der Österreichische Bibelübersetzer ein zweifaches Anliegen: die Heilige Schrift zum Zentrum seines Glaubens und dem seiner Mitchristen zu machen und dadurch einen rechtgläubigen Standpunkt zu finden. Dass der Übersetzer und Autor ungeachtet seines Bescheidenheitstopos ein gebildeter Mann gewesen sein muss, wird aus seinem Werk unmittelbar deutlich. Seine gründlichen Lateinkenntnisse sprechen ebenso dafür wie seine theologischen Schriften und sein Fürstenspiegel.
Am bemerkenswertesten aber ist der starke Impetus, die Texte der Heiligen Schrift nicht nur für den lesekundigen Laien zugänglich zu machen, sondern sie auch inhaltlich zu erschließen. Zu diesem Zweck konzipierte der Österreichische Bibelübersetzer das um 1330 entstandene Klosterneuburger Evangelienwerk als harmonisierte Evangeliendarstellung. Der Text folgt chronologisch dem Leben Jesu. Er bietet jeweils eine Perikope, gefolgt von einer Rubrik mit einer Inhaltsangabe und einem Kommentar. Dem Österreichischen Bibelübersetzer geht es also im Evangelienwerk mehr um die Vermittlung des Lebens Jesu als um eine wortgetreue Übersetzung des kanonischen Textes. Dies unterscheidet seine Arbeit von der Martin Luthers und anderer späterer Übersetzungsarbeiten.
Ein bleibendes Geheimnis
Wer sich hinter der anonym gebliebenen Person des Österreichischen Bibelübersetzers verbirgt, ist ein Geheimnis, das bis heute nicht gelüftet werden konnte. Die Fundorte der Handschriften seiner Werke sprechen für eine Herkunft aus dem Gebiet des heutigen Österreich. Dieser Befund wird auch durch einige sprachliche Eigenheiten des eleganten Textes verstärkt. Wichtiger als der Name oder die Herkunft des Übersetzers ist allerdings seine Intention. Diese bestand darin, den Text der Heiligen Schrift für eine breitere Öffentlichkeit so zu erschließen und mit der Lehrtradition der Kirche zu verbinden, dass subjektive Meinungen und häretische Ideologien wirksam zurückgedrängt werden können. Die in Verkündigung und Mission wirkmächtige franziskanische Bewegung scheint die Arbeit des Österreichischen Bibelübersetzers aus diesem Grund unterstützt zu haben.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.